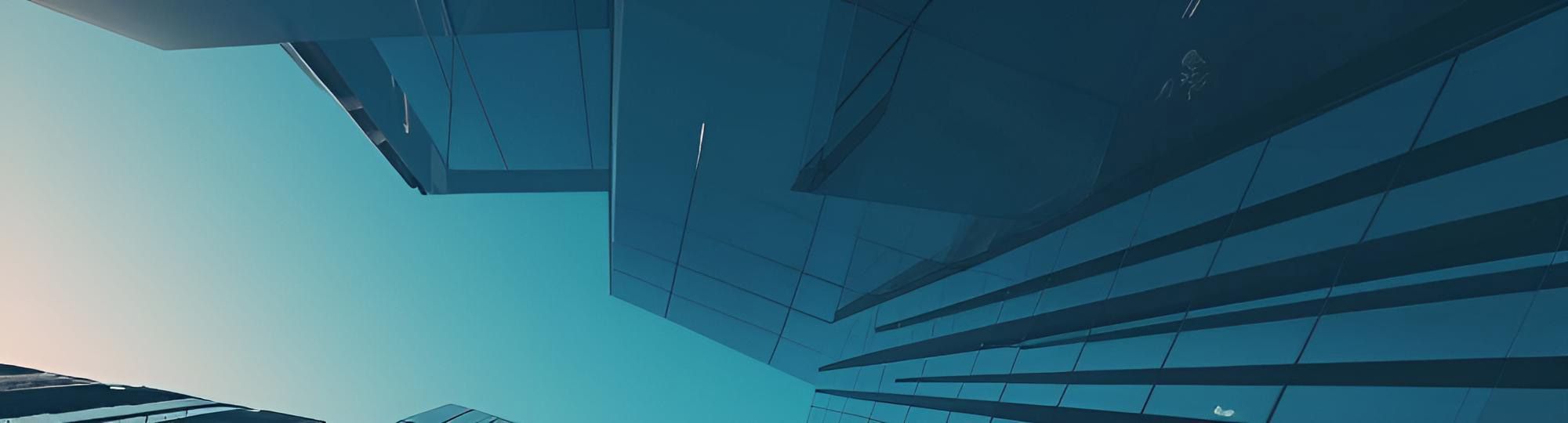Mithilfe der CSRD soll die Nachhaltigkeitsberichterstattung unter dem Rahmenwerk des EU-Green-Deals vereinheitlicht werden, um gemäß der Green Claims Directive Greenwashing zu verhindern und die Vergleichbarkeit zu verbessern. Die CSRD ist damit ein regulatorisches Mittel, dass die EU auf dem Weg zur Erfüllung der Anforderungen des EU-Green-Deals unterstützt.
Der Nachhaltigkeitsbericht
Um die sogenannten ESG-ratings zu erstellen, bedarf es bestimmter Kennzahlen. Diese Kennzahlen sollen in bis zu 1.100 Datenpunkten, die die bereiche Environmental, Social und Governance abdecken, im Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD veröffentlicht werden. Der Nachhaltigkeitsbericht steht auf einer Stufe mit dem Konzernlagebericht und soll streng kontrolliert werden; bei fehlerhafter Erstellung oder Verletzung der Berichtspflicht drohen umfangreichen Strafen. Neben der regulatorischen Verpflichtung dient der Nachhaltigkeitsbericht zur umfassenden Beschäftigung mit dem Thema ESG und fordert eine exakte Datenerfassung und konkrete Zielsetzung. Der Nachhaltigkeitsbericht soll im ESEF-Format (European Single Electronic Format) erstellt werden und kann daher digital ausgewertet werden.
Berichtspflicht
Die Berichtspflicht für den CSRD-Nachhaltigkeitsbericht greift stufenweise für verschiedene Kategorien von Unternehmen. Nicht alle Unternehmen sind gleichermaßen verpflichtet den Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, entscheidend sind verschiedene Faktoren, wie die Anzahl der Mitarbeitenden und der Jahresumsatz. Dabei gibt es die folgenden Stufen der Berichtspflicht:
- bereits jetzt: Unternehmen die bereits nach der Non Financial Reporting Directive (NFRD) berichtspflichtig sind.
- ab dem Geschäftsjahr 2024 (Veröffentlichung Anfang 2025): Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitenden
- ab dem Geschäftsjahr 2025 (Veröffentlichung Anfang 2026): Unternehmen die mindestens zwei der folgenden Bedingungen erfüllen:
- 25 Mio. Euro Bilanzsumme
- 50 Mio. Euro Umsatzerlöse
- 250 Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt
- ab dem Geschäftsjahr 2026 (Veröffentlichung Anfang 2027): kapitalmarktorientierte KMU
Inhalt des Berichts
Datenpunkte der Bereiche Environment, Social und Governance, die in den folgenden Stichpunkten dargestellt sind, werden den Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts bestimmen. Für bestimmte Branchen und Unternehmensgrößen wird der Umfang durch Referenzdokumente noch begrenzt. Darüber hinaus grenzt die Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse den Umfang des Berichts weiter ein.
Allgemeine Informationen:
Voraussetzungen, Offenlegungen
Environment:
Klimawandel, Verschmutzung, Wasserverbrauch, Biodiversität und Ökosysteme, Ressourcenverbrauch und Kreislaufwirtschaft
Social:
eigene Belegschaft, Belegschaft in der Wertschöpfungskette, Betroffene Bevölkerungsgruppen, Konsumenten und End-Kunden
Governance:
unternehmerisches Handeln
Die Wesentlichkeitsanalyse
Das zentrale Instrument, um aus den 1.100 Datenpunkten der ESRS die für die Unternehmung relevanten herauszufiltern, ist die Wesentlichkeitsanalyse. Dafür werden die Datenpunkte unter dem System der doppelten Wesentlichkeit betrachtet. Die doppelte Wesentlichkeit beschreibt die Betrachtung der Nachhaltigkeitsaspekte der ESRS aus zwei Blickrichtungen: der outside-in Betrachtung, die die Risiken für die Unternehmung aufgrund von Einflüssen der Umwelt und Gesellschaft auf sie beschreibt, und der inside-out Betrachtung, die den Einfluss des Unternehmens auf die Umwelt und die Gesellschaft darstellt. Der Ablauf der Wesentlichkeitsanalyse sollte der folgenden Struktur folgen:
Stakeholder identifizieren und einbinden
Dabei sollen die Stakeholder identifiziert werden, die durch die Unternehmung beeinflusst werden, aber auch diejenigen, die Einfluss auf die Unternehmung haben. Stakeholder sollen dazu befragt werden, in welchen Bereichen das Unternehmen den größten Einfluss hat und wo die größten Auswirkungen, Chancen und Risiken liegen.Potenziell relevante Nachhaltigkeitsthemen identifizieren
In diesem Abschnitt sollen die sektorspezifischen Nachhaltigkeitsthemen sowie unternehmensspezifische Themen identifiziert werden. Dafür können Ergebnisse aus Branchenberichten oder dem Risikomanagement herangezogen werden. Die Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette und geografischer Wirkungsgebiete ist zudem oft von relevanz.Auswirkungen, Chancen und Risiken definieren
Die vorher definierten Nachhaltigkeitsaspekte werden in diesem Schritt auf Auswirkungen, Chance und Risiken analysiert. Sind die gefundenen Aspekte wirklich wesentlich?Impacts bewerten
Die gefundenen Aspekte sollen nun quantifiziert werden. Es soll nicht mehr nur untersucht werden, ob die Aspekte wesentlich sind, sondern auch, wie hoch entstehende Kosten oder resultierenden Schäden sind. Dafür können Interviews, Befragungen, Workshops und Umfragen wichtige Instrumente sein. Eine besondere Schwierigkeit dabei stellt die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit verschiedenen Einheiten dar.Finanzielle Chancen und Risiken definieren
Dieser Abschnitt steht unter den Leitfragen:- Inwiefern können aktuelle Ressourcen weiterhin genutzt
- Inwieweit können bestehende Beziehungen aufrechterhalten werden?
Ein Verständnis über die Lieferkette, die Regulatorik, aktuelle Entwicklungen und die Nachfrage der Kund:innen der Zukunft sind dabei relevant. Risiken von Reputationsschäden durch falsches Handeln oder Nichthandeln müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
Wesentlichkeitsübersicht erstellen
In diesem Schritt sollen die Aspekte nach der Wesentlichkeit sortiert werden. Die Schwierigkeit besteht darin,
eine Schwelle festzuelgen, ab der Aspekte nicht mehr als wesentlich angesehen werden, um in die Umsetzung überzugehen. Das Ziel sollte es dabei sein, alle relevanten Aspekte zu behalten, ohne den Fokus auf die wichtigsten zu verlieren.Strategische Implementierung
Die CSRD verlangt die Offenlegung der Maßnahmen und Aktionspläne, die getroffen werden, um die Ziele, die durch Kennzahlen und Richtlinien definiert wurden, zu erreichen.